Casparini, Eugen
- Lebensdaten
- 1623 – 1706
- Geburtsort
- Sorau (Niederlausitz)
- Sterbeort
- Wiesau (heute Neuwiesau, Schlesien)
- Beruf/Funktion
- Orgelbauer ; Musikinstrumentenbauer
- Konfession
- mehrkonfessionell
- Normdaten
- GND: 130581135 | OGND | VIAF: 50338127
- Namensvarianten
-
- Caspari, Eugen
- Caspar, Eugen
- Casparini, Johann (ursprünglich)
- Casparini, Eugenius
- Casparini, Eugen
- Caspari, Eugen
- Caspar, Eugen
- Casparini, Johann (ursprünglich)
- casparini, johann
- Casparini, Eugenius
- Barberi, Eugen
- Casparini, Eugenio Johann
- Casperini, Eugenius
- Gasperini, Eugen
- Zeparini, Eugen
- Kasparini, Eugen
- Kaspari, Eugen
- Kaspar, Eugen
- Kasparini, Johann (ursprünglich)
- Kasparini, Eugenius
- Kasparini, Eugenio Johann
- Kasparini, Johann
- Kasperini, Eugenius
Vernetzte Angebote
- Deutsche Digitale Bibliothek
- Thesaurus des Consortium of European Research Libraries (CERL)
- Normdateneintrag des Südwestdeutschen Bibliotheksverbundes (SWB)
- * Literaturnachweis in der Neuen Deutschen Biographie (NDB)
- * Werknachweis in der Neuen Deutschen Biographie (NDB)
- * musiconn - Für vernetzte Musikwissenschaft
- Index Theologicus (IxTheo)
Verknüpfungen
Personen in der NDB Genealogie
Orte
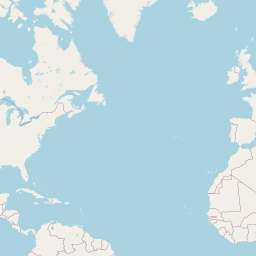

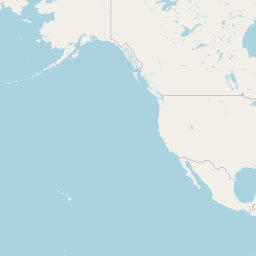

Symbole auf der Karte
 Geburtsort
Geburtsort
 Wirkungsort
Wirkungsort
 Sterbeort
Sterbeort
 Begräbnisort
Begräbnisort
Auf der Karte werden im Anfangszustand bereits alle zu der Person lokalisierten Orte eingetragen und bei Überlagerung je nach Zoomstufe zusammengefaßt. Der Schatten des Symbols ist etwas stärker und es kann durch Klick aufgefaltet werden. Jeder Ort bietet bei Klick oder Mouseover einen Infokasten. Über den Ortsnamen kann eine Suche im Datenbestand ausgelöst werden.
-
Casparini (Caspar[i]), Eugen (ursprünglich Johann)
Orgelbauer, * 14.2.1623 Sorau (Niederlausitz), † 12.9.1706 Wiesau (heute Neuwiesau, Schlesien) (evangelisch, dann (römisch)-katholisch, dann wieder evangelisch)
-
Genealogie
V →Adam (1590–1665), Orgelbauer u. Mathematicus in Sorau;
M Elis. Lange;
B George Adam, Orgelbauer in Sorau;
⚭ Venedig 1672 Elis. Sportella;
S Adam Horatio (* 1676 Padua, † 11.8.1745 Breslau, kath.), Schüler C.s, einer der begehrtesten u. hervorragendsten Orgelbauer Schlesiens in der 1. Hälfte der 18. Jh. (1725 Kloster Czenstochau, 1737 Lissa, ferner 11 000 Jungfrauen u. St. Adalbert in Breslau, 1740 Dominikanerkirche Glogau), baute außer dem Register Unda maris auch eine labiale Vox humana;
E Joh. Gottlob, Orgelbauer, →Adam Gottl. (1705–88), Orgelbauer in Ostpreußen (s. Altpreuß. Biogr.). -
Biographie
C. erlernte den Orgelbau bei seinem Vater. Etwa um 1638 oder 1639 begab er sich auf die Wanderschaft und arbeitete zunächst drei Jahre in Regensburg, dann hat er dem Herzog von Friaul und der Republik Venedig 30 Jahre gedient. In Görz wirkte C. 10 Jahre als Organist und Orgelbauer. In dieser Zeit trat er zum Katholizismus über, wobei er den Namen Eugen angenommen haben dürfte. Von etwa 1669 ab ist er in Padua, vorübergehend aber auch wieder in Venedig tätig. Er wohnte 28 Jahre in Padua und hatte dort seinen Hauptwirkungskreis. Auch in Südtirol baute er eine Anzahl bedeutender Orgelwerke. In Wien besserte er am kaiserlichen Hof verschiedene Orgeln aus und schenkte der kaiserlichen Kunstkammer ein Positiv, dessen Pfeifen aus Papier gefertigt waren. 1686 wurde C. durch Kaiser Leopold I. zum Maestro d'organi ernannt. 1697 kehrte er nach Schlesien zurück und baute dort unter anderem in Görlitz die berühmte „Sonnenorgel“ zu Sankt Peter und Paul, deren einzigartiger Prospekt bis heute erhalten ist. Das Werk wurde 1703 von ihm vollendet. Als Orgelbauer genoß C. einen Ruhm wie wenige Meister seiner Zeit. Durch seine Kenntnisse des italienischen Orgelbaus befruchtete er den deutschen. So schuf er neue Klangfarben und baute in seine Orgeln schwebende und streichende Stimmen wie Unda maris und Viola di Gamba ein. Die von ihm mensurierten und intonierten Aliquoten und Mixturen gaben seinen Werken einen strahlenden Glanz. C. erfand ferner die kanzellenlose Schleiflade, die jeder Pfeife eine volle Windzufuhr garantiert. Vor seinem Tode wurde er wieder Protestant.
-
Werke
Weitere W Orgeln im Dom in Trient, 1656;
im Kloster Marienberg,1675;
in S. Maria Maggiore in Trient, 1686 (1707 v. Händel gespielt);
in Brixen, 1689. -
Literatur
ADB IV;
J. Ch. Schwedler, Lpr. (Kirchenbibl. St. Peter u. Paul, Liegnitz);
E. Flade, in: Biehle-Festschr., 1931, S. 18-26;
ders., Gottfr. Silbermann, Neuaufl. 1953;
MGG. -
Autor/in
Thekla Schneider -
Zitierweise
Schneider, Thekla, "Casparini, Eugen" in: Neue Deutsche Biographie 3 (1957), S. 165 [Online-Version]; URL: https://www.deutsche-biographie.de/pnd130581135.html#ndbcontent

