Welte
- Lebensdaten
- erwähnt 19./20. Jahrhundert
- Beruf/Funktion
- Unternehmer ; Musikinstrumentenbauer
- Konfession
- katholisch
- Namensvarianten
-
- Welte
Vernetzte Angebote
Verknüpfungen
Personen im NDB Artikel
Orte
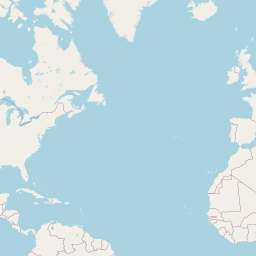

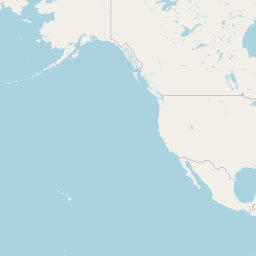

Symbole auf der Karte
 Geburtsort
Geburtsort
 Wirkungsort
Wirkungsort
 Sterbeort
Sterbeort
 Begräbnisort
Begräbnisort
Auf der Karte werden im Anfangszustand bereits alle zu der Person lokalisierten Orte eingetragen und bei Überlagerung je nach Zoomstufe zusammengefaßt. Der Schatten des Symbols ist etwas stärker und es kann durch Klick aufgefaltet werden. Jeder Ort bietet bei Klick oder Mouseover einen Infokasten. Über den Ortsnamen kann eine Suche im Datenbestand ausgelöst werden.
-
Welte
Unternehmer, Hersteller von selbstspielenden Musikinstrumenten. (katholisch)
-
Biographie
Die zumeist im Schwarzwald ansässige Familie erlangte durch die Herstellung selbstspielender Musikinstrumente große Berühmtheit. →Michael (28. 9. 1807 –17. 1. 1880), Sohn eines Weißgerbers, ging beim Unterkirnacher Spieluhrenmacher Jakob Blessing (1799–1879) in die Lehre und gründete 1832 in seinem Heimatort Vöhrenbach (Schwarzwald) zunächst eine Werkstatt für Flötenuhren „Gebrüder Welte“, in der teils sein älterer Bruder →Valentin (1799–1876), evtl. auch sein jüngerer Bruder →Fidelis mitarbeiteten. Michael heiratete 1838 →Maria Adelheidis Ganter (1819–57); acht ihrer elf Kinder erreichten das Erwachsenenalter. Ab 1845 baute Michael unter seinem eigenen Namen Orchestrion-Instrumente und etablierte 1866 eine Niederlassung in New York, die sein Sohn →Emil (1841–1923), ein gelernter Uhrmacher mit Ausbildung in Harmonielehre, führte. In die Vöhrenbacher Firma stiegen die jüngeren Söhne →Berthold (1843–1918) und →Michael jun. (1846–1920) ein. 1872 zog sie nach Freiburg (Br.) um, wo sie unter „M. Welte & Söhne“ firmierte. Die Firma Welte war maßgeblich beteiligt am Wechsel von der Stiftwalze hin zu pneumatisch lesbaren Notenrollen aus Papier, die sich besser vervielfältigen ließen und weitere Ebenen der Codierung boten. 1883 erhielt Emil das US-Patent 287.599 sowie das dt. Reichspatent 26.733 für diese Art Programmträger, die er zunächst für Orchestrien einsetzte.
-
Familienmitglieder
-
Zitierweise
Wolf, Rebecca, "Welte" in: Neue Deutsche Biographie 27 (2020), S. 753 [Online-Version]; URL: https://www.deutsche-biographie.de/sfz140369.html#ndbcontent

