Butenandt, Adolf
- Lebensdaten
- 1903 – 1995
- Geburtsort
- Lehe (heute Bremerhaven)
- Sterbeort
- München
- Beruf/Funktion
- Biochemiker ; Wissenschaftspolitiker ; Hochschullehrer ; Nobelpreisträger
- Konfession
- evangelisch-lutherisch
- Normdaten
- GND: 118935763 | OGND | VIAF: 111438122
- Namensvarianten
-
- Butenandt, Adolf Friedrich Johann
- Butenandt, Adolf
- Butenandt, Adolf Friedrich Johann
- Butenandt, Adolf Friedrich
- Butenandt, Adolph
Vernetzte Angebote
- * Kalliope-Verbund
- Archivportal-D
- * Deutsches Literaturarchiv Marbach - Kallías
- * Personen im Personenverzeichnis der Fraktionsprotokolle KGParl [1949-]
- Les Membres de l'Académie des sciences depuis sa création en 1666 [2017]
- Historische Mitglieder der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften (BBAW) [2005-]
- Mitglieder der Leopoldina [2006-]
- Personendaten-Repositorium der BBAW [2007-2014]
- Pressemappe 20. Jahrhundert
- Briefwechsel zwischen Eduard Spranger und Käthe Hadlich
- * Mitglieder der Bayerischen Akademie der Wissenschaften (BAdW)
- * Filmothek des Bundesarchivs [2015-]
- Nomination Database - Nobelprize.org [2014-]
- * Historisches Lexikon Bayerns
- * Nachlass Sommerfeld beim Deutschen Museum
- * Nachlassdatenbank beim Bundesarchiv
- * Katalog des Deutschen Kunstarchivs (DKA) im Germanischen Nationalmuseum
- Katalog des Bibliotheksverbundes Bayern (BVB)
- Deutsche Digitale Bibliothek
- Normdateneintrag des Südwestdeutschen Bibliotheksverbundes (SWB)
- * Landeskunde Entdecken Online - Baden-Württemberg (LEO-BW) [2015-]
- * Deutsches Literaturarchiv Marbach - Kallías
- Österreichischer Bibliothekenverbund (OBV)
- Gemeinsamer Verbundkatalog (GBV)
- Isis Bibliography of the History of Science [1975-]
- * Bibliothek des Instituts für Zeitgeschichte München - Berlin
- Index Theologicus (IxTheo)
- * Jahresberichte für deutsche Geschichte - Online
- Nomination Database - Nobelprize.org [2014-]
Verknüpfungen
Personen in der NDB Genealogie
Personen im NDB Artikel
Personen in der GND - familiäre Beziehungen
- NDB 22 (2005), S. 308 in Artikel Ruzicka, Leopold (Ružička, Leopold)
- NDB 22 (2005), S. 514 in Artikel Schäfer, Werner (Schäfer, Werner)
- NDB 23 (2007), S. 371 in Artikel Schoeller, Walter (Schoeller, Walter Julius Viktor)
- NDB 26 (2016), S. 23 in Artikel Telschow, Ernst
- NDB 26 (2016), S. 769 in Artikel Verschuer, Otmar Freiherr von (Verschuer, Otmar Reinhold Ralph Ernst Freiherr von)
- NDB 27 (2020), S. 301 (Walden, Paul von)
- NDB 27 (2020), S. 525 (Wecker, Eberhard)
Orte
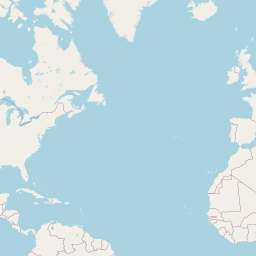

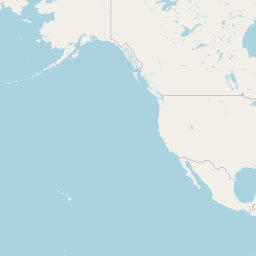

Symbole auf der Karte
 Geburtsort
Geburtsort
 Wirkungsort
Wirkungsort
 Sterbeort
Sterbeort
 Begräbnisort
Begräbnisort
Auf der Karte werden im Anfangszustand bereits alle zu der Person lokalisierten Orte eingetragen und bei Überlagerung je nach Zoomstufe zusammengefaßt. Der Schatten des Symbols ist etwas stärker und es kann durch Klick aufgefaltet werden. Jeder Ort bietet bei Klick oder Mouseover einen Infokasten. Über den Ortsnamen kann eine Suche im Datenbestand ausgelöst werden.
-
Butenandt, Adolf Friedrich Johann
1903 – 1995
Biochemiker, Wissenschaftspolitiker
Der Biochemiker Adolf Butenandt leistete grundlegende Beiträge zur Insektenendokrinologie und Chemie der Sexualhormone, wofür er 1939 den Nobelpreis für Chemie erhielt. Als Direktor des Kaiser-Wilhelm-Instituts (1937–1949) bzw. des Max-Planck-Instituts (1949–1972) für Biochemie in Berlin-Dahlem prägte er die deutschen Biowissenschaften im 20. Jahrhundert. Als Präsident der Max-Planck-Gesellschaft von 1960 bis 1972 trug er entscheidend zum Aufbau des Forschungssystems der Bundesrepublik bei.
Lebensdaten

Adolf Butenandt, Imago Images (InC) -
Autor/in
→Bernd Gausemeier (Hannover)
-
Zitierweise
Gausemeier, Bernd, „Butenandt, Adolf“ in: NDB-online, veröffentlicht am 1.4.2025, URL: https://www.deutsche-biographie.de/118935763.html#dbocontent

Nach dem Abitur 1921 an der Oberrealschule in Lehe (heute Bremerhaven) studierte Butenandt Chemie, Physik und Biologie an der Universität Marburg an der Lahn. 1924 wechselte er nach Göttingen, wo er sich unter Adolf Windaus (1876–1959) auf die chemische Analyse von Naturstoffen spezialisierte. In Marburg trat er der Turnerschaft Philippina bei, einer schlagenden Studentenverbindung, in Göttingen dem Jungdeutschen Orden, einer nationalkonservativen Vereinigung militaristischer Prägung. Butenandt wurde 1927 bei Windaus mit einer Arbeit über das pflanzliche Insektengift Rotenon zum Dr. phil. promoviert. Anschließend begann er, weiterhin in Windausʼ Institut, mit der Untersuchung des weiblichen Follikelhormons, bei der er mit der Berliner Pharmafirma Schering AG zusammenarbeitete. 1929 gelang die Reindarstellung des von Butenandt Progynon genannten Hormons, für das 1931 nach internationaler Übereinkunft der Name Oestron festgelegt wurde. Den Erfolg der ersten Isolierung eines menschlichen Sexualhormons teilte sich Butenandt mit Edward A. Doisy (1893–1986) an der Saint Louis University (Missouri, USA), der diesen Schritt einige Wochen zuvor vollzogen hatte. Entscheidenden Anteil an den Isolierungsarbeiten hatte seine leitende technische Assistentin Erika von Ziegener (1906–1995), die Butenandt 1931 heiratete.
Im selben Jahr habilitierte sich Butenandt für Organische und Biologische Chemie. Kurz darauf isolierte sein Arbeitskreis mit Androsteron das erste männliche Sexualhormon. 1932 schlug Butenandt Strukturformeln für Oestron und Androsteron vor, die sich an neuen Modellen für die Struktur der Steroide orientierten, in den folgenden Jahren durch Butenandt und seine Mitarbeiter experimentell bestätigt und zu einem Schema der biosynthetischen Beziehungen zwischen den Steroidhormonen ausgebaut wurden. Damit etablierte sich Butenandt als führende Autorität auf einem der dynamischsten Gebiete der Naturstoffchemie.
1933 wurde Butenandt auf den Lehrstuhl für Organische Chemie an der TH Danzig (Pommern, heute Gdańsk, Polen) berufen, wo weitere Erstisolierungen und Strukturbestimmungen von Steroidhormonen gelangen. Sein internationales Renommee brachte ihm 1935 ein Angebot für eine Professur an der Harvard University (Massachusetts, USA) ein, das er jedoch in der Hoffnung auf eine bessere Position in Deutschland nicht annahm. Im Mai 1936 wurde er als Nachfolger des 1934 unter Berufung auf das NS-Berufsbeamtengesetz entlassenen Carl Neuberg (1877–1956) zum Direktor des Kaiser-Wilhelm-Instituts für Biochemie (KWIBC) in Berlin ernannt. Seine Berufung war bei einigen NS-Wissenschaftsfunktionären auf Widerstand gestoßen, da er in seiner Göttinger Zeit Distanz zur NSDAP gezeigt hatte. Vermutlich auch zur Beseitigung dieser Vorbehalte wurde er zeitgleich Mitglied der NSDAP. Ohne sich politisch stark zu exponieren, zeigte sich Butenandt in der Folgezeit loyal gegenüber dem NS-Staat. Einen zeitweiligen Dämpfer erfuhr diese Identifikation, als ihm die NS-Führung untersagte, den Nobelpreis für Chemie entgegenzunehmen, der ihm 1939 gemeinsam mit seinem Konkurrenten Leopold Ružička (1887–1976) zugesprochen wurde.
Als Direktor des KWIBC verfolgte Butenandt ein erweitertes Arbeitsprogramm. In Zusammenarbeit mit der Arbeitsgruppe von Alfred Kühn (1885–1968) am benachbarten Kaiser-Wilhelm-Institut für Biologie forschte er zu den Stoffwechselwegen zwischen Genen und Merkmalen bei Insekten, was 1940 zur chemischen Beschreibung der Augenausfärbung bei Drosophila führte, der ersten Aufklärung einer epigenetischen Reaktionskette. Zu dieser Zeit begannen am KWIBC (seit 1949 Max-Planck-Institut für Biochemie) langwierige Untersuchungen an weiteren Insektenwirkstoffen, die grundlegende Ergebnisse hervorbrachten, insbesondere die Isolierung und Charakterisierung des Wachstumsregulators Ecdyson 1954 durch Peter Karlson (1918–2001) sowie des Sexuallockstoffs (Pheromons) Bombykol 1959 durch Butenandt. Mit Kühn sowie dessen Kodirektor Fritz von Wettstein (1895–1945) initiierte Butenandt Ende der 1930er Jahre die Arbeitsstätte für Virusforschung der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft, deren Beiträge zur Strukturanalyse des Tabakmosaikvirus eine wichtige Rolle in der internationalen Diskussion um die Struktur des genetischen Materials spielten. Das Projekt legte die Grundlage für den Einstieg des Butenandtʼschen Arbeitskreises in die Proteinstrukturforschung.
Während des Zweiten Weltkriegs richtete Butenandt einen Teil der Institutsarbeiten auf militärmedizinische Zielsetzungen aus. In einigen Fällen waren Mitarbeiter seines Instituts an Versuchen an nicht einwilligungsfähigen Menschen beteiligt, so in zwei Fällen bei der Verabreichung von Substanzen an Kriegsgefangene. Gerhard Ruhenstroth-Bauer (1913–2004) war mitverantwortlich für einen Versuch, bei dem epilepsieveranlagte Kinder aus der Euthanasieanstalt Brandenburg-Görden Unterdruck ausgesetzt wurden. Es ist in keinem Fall nachzuweisen, dass Butenandt Versuche veranlasste, bei denen eine schwere Schädigung von Probanden zu erwarten war. Er äußerte allerdings keine grundsätzlichen Bedenken dagegen, dass seine Mitarbeiter die Möglichkeiten des NS-Lagersystems für Humanversuche nutzten.
Butenandt verlegte das KWIBC 1944 nach Tübingen, übernahm 1945 an der dortigen Universität die Professur für Physiologische Chemie und führte dank guter Beziehungen zu den französischen Besatzungsbehörden den Betrieb des KWIBC weiter. 1949 wurde das Institut in die neu gegründete Max-Planck-Gesellschaft (MPG) eingegliedert. 1950 wurde Butenandt von der Spruchkammer der Universität Tübingen als „entlastet“ entnazifiziert. Zu diesem Zeitpunkt hatte sein Aufstieg zu einem der einflussreichsten Wissenschaftsmanager der jungen Bundesrepublik bereits begonnen: Er wurde 1949 Gründungsmitglied des Forschungsrats, Senator der MPG und Vizepräsident der Deutschen Forschungsgemeinschaft und trug entscheidend zum Ausbau des Forschungsstandorts Tübingen bei.
1956 folgte Butenandt dem Ruf auf die Professur für Physiologische Chemie an der Universität München; auch sein Max-Planck-Institut für Biochemie übersiedelte in die bayerische Landeshauptstadt. 1960 wurde er Präsident der MPG. In seiner bis 1972 währenden Amtszeit stärkte er die Stellung des Präsidenten und der Generalverwaltung. Unter seiner Ägide wurde München zum administrativen Zentrum und größten Forschungsstandort der Gesellschaft; Budget und Personalstand der MPG erfuhren ein nie wieder erreichtes Wachstum.
Zahlreiche Schüler und Mitarbeiter Butenandts leisteten wesentliche Beiträge zum Aufbau der Biochemie und Molekularbiologie in der Bundesrepublik, etwa Karlson auf dem Gebiet der Insektenhormone, Gerhard Schramm (1910–1969) in der Virologie, Gerhard Braunitzer (1921–1989) in der Proteinstrukturforschung und Peter Hans Hofschneider (1929–2004) in der Phagengenetik.
| 1934 | Mitglied der Leopoldina (1955–1960 Vizepräsident, 1960 Ehrenmitglied) |
| 1935 | Emil-Fischer-Gedenkmünze des Vereins Deutscher Chemiker |
| 1936 | Pasteur-Medaille der Universität Paris |
| 1937 | Scheele-Medaille der Universität Stockholm |
| 1938 | Mitglied der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen |
| 1939 | Mitglied der Preußischen Akademie der Wissenschaften, Berlin (1969 auswärtiges Mitglied der Akademie der Wissenschaften der DDR) |
| 1939 | Nobelpreis für Chemie (mit Leopold Ružička, 1887–1976) |
| 1949 | Dr. med. h. c., Universität Tübingen |
| 1949 | Mitglied der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, München |
| 1950 | Dr. med. vet. h. c., Universität München |
| 1953 | Paul-Ehrlich-und-Ludwig-Darmstädter-Preis |
| 1953 | Ehrenmitglied der New York Academy of Sciences |
| 1956 | Dr. rer. nat. h. c., Universität Tübingen |
| 1957 | Dr. phil. h. c., Universität Graz |
| 1959 | Großes Verdienstkreuz mit Stern und Schulterband des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland (1985 Großkreuz) |
| 1960 | Ehrenbürger der Stadt Bremerhaven |
| 1961 | Dr. Sc. h. c., Universität Leeds |
| 1962 | Bayerischer Verdienstorden |
| 1962 | Mitglied des Ordens Pour le Mérite für Wissenschaften und Künste |
| 1963 | Dr. med. h. c., Universität Thessaloniki |
| 1963 | Dr. h. c., Universität Madrid |
| 1963 | Orden der aufgehenden Sonne II. Klasse, Japan |
| 1964 | Österreichisches Ehrenzeichen für Wissenschaft und Kunst |
| 1965 | Dr. Sc. h. c., Saint Louis University (Missouri, USA) |
| 1965 | Ehrenmitglied der Japanischen Akademie der Wissenschaften |
| 1966 | Dr. Ing. e. h., TU Berlin |
| 1966 | Dr. Sc. h. c., Universität Cambridge |
| 1968 | ausländisches Mitglied der Royal Society, London |
| 1969 | Commandeur der Ehrenlegion, Frankreich |
| 1969 | Ehrenmitglied der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien |
| 1970 | Dr. med. h. c., Universität Bukarest |
| 1972 | Ehrenpräsident der Max-Planck-Gesellschaft |
| 1972 | Commandeur dans l‘Ordre des Palmes Académiques |
| 1972 | Dr. h. c., Universität René Descartes Paris |
| 1973 | Adolf-von-Harnack-Medaille der Max-Planck-Gesellschaft |
| 1973 | Dr. rer. nat. h. c., Yonsey Universität Seoul |
| 1974 | auswärtiges Mitglied der Académie des Sciences de l’Institut de France |
| 1978 | Ehrenmitglied der Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte |
| 1981 | Bayerischer Maximiliansorden für Wissenschaft und Kunst |
| 1981 | Ehrenmitglied der Gesellschaft Deutscher Chemiker |
| 1985 | Ehrenbürger der Stadt München |
| 1994 | Großes Goldenes Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich |
Nachlass:
Archiv der Max-Planck-Gesellschaft, Berlin-Dahlem, III. Abt., Rep. 84.
Weitere Archivmaterialien:
Archiv der Max-Planck-Gesellschaft, Berlin-Dahlem, II. Abt., Rep. 1A (Personalakte), II. Abt., Rep. 41 (Max-Planck-Institut für Biochemie) u. II. Abt., Rep. 57, Nr. 199. (Präsidium MPG, Wahl der Präsidenten Butenandt, Hahn und Planck)
Landesarchiv Baden-Württemberg, Abt. Hauptstaatsarchiv Stuttgart, EA 3/150 Bü 303. (Personalakte)
Landesarchiv Baden-Württemberg, Abt. Staatsarchiv Sigmaringen, Wü 2 T 1 Nr. 1518 (Neubauten Kaiser-Wilhelm-Institute in Tübingen) u. Wü 13 T 2 Nr. 2633/297. (Spruchkammerentscheid)
Universitätsarchiv Tübingen, 205/116. (Lehrstuhlakten Chemie 1927–1956)
Monografien:
Über die chemische Konstitution des Rotenons, des physiologisch wirksamen Bestandteils der Derris elliptica, 1928. (Diss. phil.)
Untersuchungen über das weibliche Sexualhormon (Follikel- oder Brunsthormon), 1931. (Habilitationsschrift)
Die biologische Chemie im Dienste der Volksgesundheit. Festrede, 1941.
Das Werk eines Lebens, 4 Bde., 1981
Aufsätze:
Über „Progynon“, ein krystallisiertes weibliches Sexualhormon, in: Die Naturwissenschaften 17 (1929), S. 879.
Über die Isolierung und Reindarstellung des männlichen Sexualhormons (Testikelhormons), in: Forschungen und Fortschritte 8 (1932), S. 60.
Chemical Constitution of the Follicular and Testicular Hormones, in: Nature 130 (1932), S. 238–240.
Adolf Butenandt/Ulrich Westphal, Zur Isolierung und Charakterisierung des Corpus-luteum-Hormons, in: Berichte der deutschen chemischen Gesellschaft 67 (1934), S. 1440–1442.
Adolf Butenandt/Wolfhard Weidel/Erich Becker, Kynurenin als Augenpigmentierung auslösendes Agens bei Insekten, in: Die Naturwissenschaften 28 (1940), S. 63.
Neuere Beiträge der Chemie zum Krebsproblem, in: Angewandte Chemie 53 (1940), S. 345–352.
Entwicklungslinien in der künstlichen Darstellung natürlicher Steroidhormone, in: Die Naturwissenschaften 30 (1942), S. 4–17.
Adolf Butenandt/Hans Friedrich-Freksa/St. Hartwig/Günther Scheibe, Beitrag zur Feinstruktur des Tabakmosaikvirus, in: Hoppe-Seyler’s Zeitschrift für Physiologische Chemie 274 (1942), S. 276–284.
Adolf Butenandt/Erich Hecker, Synthese des Bombykols, des Sexual-Lockstoffes des Seidenspinners und seiner geometrischen Isomeren, in: Angewandte Chemie 73 (1961), S. 349–353.
Molekulare Biologie als Fundament der modernen Medizin, in: Münchener Medizinische Wochenschrift 108 (1966), H. 34, S. 1625–1629.
Geschichte und Konzeption des Instituts, in: Max-Planck-Institut für Biochemie Martinsried. Max-Planck-Gesellschaft. Berichte und Mitteilungen 2 (1977), S. 11–21.
Monografien und Sammelbände:
Peter Karlson, Adolf Butenandt. Biochemiker, Hormonforscher, Wissenschaftspolitiker, 1990.
Robert N. Proctor, Adolf Butenandt (1903–1995). Nobelpreisträger, Nationalsozialist und MPG-Präsident. Ein erster Blick in den Nachlass, 2000.
Jeffrey Lewis, Continuity in German Science, 1937–1972. Genealogy and Strategies of the TMV/Molecular Biology Community. Ph. D. Thesis Ohio State University 2002.
Achim Trunk, Zweihundert Blutproben aus Auschwitz. Ein Forschungsvorhaben zwischen Anthropologie und Biochemie (1943–1945), 2003.
Sven Kinas, Adolf Butenandt (1903–1995) und seine Schule, 2004.
Wolfgang Schieder/Achim Trunk (Hg.), Adolf Butenandt und die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft. Wissenschaft, Industrie und Politik im „Dritten Reich“, 2004.
Bernd Gausemeier, Natürliche Ordnungen und politische Allianzen. Biologische und biochemische Forschung an Kaiser-Wilhelm-Instituten 1933–1945, 2005.
Michael Schüring, Minervas verstoßene Kinder. Vertriebene Wissenschaftler und die Vergangenheitspolitik der Max-Planck-Gesellschaft, 2006. S. 249–260 u. 315–321.
Rüdiger Hachtmann, Wissenschaftsmanagement im „Dritten Reich“. Geschichte der Generalverwaltung der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft, 2 Bde., 2007.
Heiko Stoff, Wirkstoffe. Eine Wissenschaftsgeschichte der Hormone, Vitamine und Enzyme, 1920–1970, 2012.
Jaromir Balcar, Wandel durch Wachstum in „dynamischen Zeiten“. Die Max-Planck-Gesellschaft 1955 bis 1972, 2020. (Onlineressource)
Jürgen Renn/Carsten Reinhardt/Jürgen Kocka (Hg.), Die Max-Planck-Gesellschaft. Wissenschafts- und Zeitgeschichte 1945–2005, 2024, S. 88–103 u. 578–571.
Aufsätze:
Benno Müller-Hill, Das Blut von Auschwitz und das Schweigen der Gelehrten, in: Doris Kaufmann (Hg.), Geschichte der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft im Nationalsozialismus. Bestandsaufnahme und Perspektiven der Forschung, Bd. 1, 2000, S. 189–227.
Hans-Jörg Rheinberger, Virusforschung an den Kaiser-Wilhelm-Instituten für Biochemie und für Biologie 1937–1945, in: Doris Kaufmann (Hg.), Geschichte der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft im Nationalsozialismus. Bestandsaufnahme und Perspektiven der Forschung, Bd. 2, 2000, S. 667–698.
Benno Müller-Hill, Erinnerung und Ausblendung. Ein kritischer Blick in den Briefwechsel Adolf Butenandts, MPG-Präsident 1960–1972, in: History and Philosophy of the Life Sciences 24 (2002), H. 3/4, S. 493–521.
Angelika Ebbinghaus/Karl-Heinz Roth, Von der Rockefeller Foundation zur Kaiser-Wilhelm/Max-Planck-Gesellschaft. Adolf Butenandt als Biochemiker und Wissenschaftspolitiker des 20. Jahrhunderts, in: Zeitschrift für Geschichtswissenschaft 50 (2002), S. 389–419.
Bernd Gausemeier, Rassenhygienische Radikalisierung und kollegialer Konsens, in: Carola Sachse (Hg.), Die Verbindung nach Auschwitz. Biowissenschaften und Menschenversuche an Kaiser-Wilhelm-Instituten. Dokumentation eines Symposiums, 2003, S. 178–198.
Edmund Marsch, Adolf Butenandt als Präsident der Max-Planck-Gesellschaft 1960–1972. Zum 100. Geburtstag am 24. März 2003, in: Dahlemer Archivgespräche 9 (2003), S. 134–145.
Achim Trunk, Max-Planck-Institut für Biochemie Berlin – Martinsried, in: Peter Gruss/Reinhard Rürup (Hg.), Denkorte. Max-Planck-Gesellschaft und Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft. Brüche und Kontinuitäten 1911–2011, 2010, S. 266–275.
Lexikonartikel:
J. C. Poggendorffs biographisch-literarisches Handwörterbuch der exakten Naturwissenschaften, Bd. 6, 1936, S. 379 f., Bd. 7a, 1956, S. 1325–328 u. Bd. 8, 1999, S. 672–675. (W, L, A)
Horst Remane, Art. „Butenandt, Adolf Friedrich Johann“, in: Hans-Ludwig Wußing (Hg.), Fachlexikon abc. Forscher und Erfinder, 1992, S. 105. (P)
Bernd Gausemeier, Art. „Butenandt, Adolf“, in: Encyclopedia of Life Sciences Online, 2015.
Adolf Butenandt. Präsident der Max-Planck-Gesellschaft 1960–1972, in: Max-Planck-Gesellschaft.
Adolf Butenandt. Biographical, in: The Nobel Prize.
Interview mit Adolf Butenandt, in: Deutsche Welle Radio.
Adolf Butenandt, in: Orden Pour Le Mérite für Wissenschaften und Künste. (P)
Fotografien, 1951–1967, Bildarchiv der Bayerischen Staatsbibliothek, München.
Fotografie, Nobel Foundation Archive.
Fotografien, 1910–1993, Archiv zur Geschichte der Max-Planck-Gesellschaft, Berlin-Dahlem.

