Höegh, Emil von
- Dates of Life
- 1865 – 1915
- Place of birth
- Löwenberg (Schlesien)
- Place of death
- Goslar
- Occupation
- technischer Mathematiker
- Religious Denomination
- evangelisch
- Authority Data
- GND: 116926120 | OGND | VIAF: 72158104
- Alternate Names
-
- Höegh, Emil von
- Höegh, Emil von
Linked Services
Relations
Places
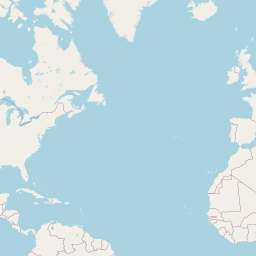

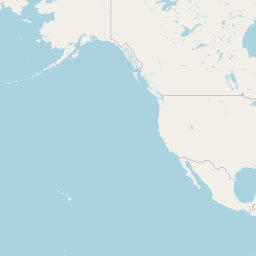

Map Icons
 Place of birth
Place of birth
 Place of activity
Place of activity
 Place of death
Place of death
 Place of interment
Place of interment
Localized places could be overlay each other depending on the zoo m level. In this case the shadow of the symbol is darker and the individual place symbols will fold up by clicking upon. A click on an individual place symbol opens a popup providing a link to search for other references to this place in the database.
-
Höegh, Emil von
technischer Mathematiker, * 10.5.1865 Löwenberg (Schlesien), † 29.1.1915 Goslar. (evangelisch)
-
Genealogy
V Kuno Wase, Zivil-Ing.;
M Wilh. Christiane Magd. Dreis;
⚭ Joh. Emilie Augustine Hackbarth. -
Biography
Über den beruflichen Werdegang von H. ist nur wenig bekannt. Er tauchte unvermittelt auf, als er 1892 bei dem Begründer der Optischen Anstalt C. P. Goerz in Berlin vorsprach und behauptete, daß er einen leistungsfähigeren photographischen Anastigmat schaffen könne, der dem Stand der Technik voraus sei. Ein nach den Angaben H.s angefertigtes Versuchsmuster, der photographische Doppelanastigmat, ließ in einer Prüfkamera bei kritischer und gründlicher Untersuchung einen so hohen Erfolg in der Abbildungsleistung erkennen, daß H. sofort als Mitarbeiter engagiert wurde. 1902 schied er wegen eines Herzleidens vorzeitig aus. – Der H.sche Doppelanastigmat war für Goerz jahrelang ein derartiger Verkaufserfolg, daß die Berliner Fabrikanlagen wiederholt erweitert und auswärtige Fabrikationsstellen, insbesondere in Winterstein (Thüringen), einbezogen werden mußten. Außerhalb Deutschlands wurden Verkaufsfilialen in Paris, London und New York gegründet, ferner wurden Lizenzen nach England vergeben, und die amerikanische Firma Kodak wurde als Kunde gewonnen. Bei Goerz erfand H. noch weitere photographische Objektivtypen, deren Bildleistung für die damalige Zeit beachtlich war. 1901 wurde das 100 000. Objektiv fertiggestellt. 1900 gab H. den nach ihm heute noch benannten Meniskus an, eine dicke Linse mit je einer Konkav- und Konvexfläche gleicher Krümmung, wodurch eine Grundbedingung (Petzvalsche Bedingung) für die Bildfeldebnung bei großen Bildfeldwinkeln realisierbar wurde. Auf dieser Grundlage beruhte der von H. 1900 errechnete Weitwinkel-Anastigmat Hologon mit dem Bildfeldwinkel 135º. Der H.sche Meniskus wird seit 1938 auch bei gewissen Mikroskopobjektiven (Planachromaten und Planapochromaten) speziell für die moderne Color-Mikrophotographie als bildfeldebnendes Element angewandt.
-
Literature
Festschr., hrsg. v. d. Opt. Anstalt C. P. Goerz AG, 1886–1911, 1911.
-
Author
Johannes Flügge -
Citation
Flügge, Johannes, "Höegh, Emil von" in: Neue Deutsche Biographie 9 (1972), S. 307 [online version]; URL: https://www.deutsche-biographie.de/pnd116926120.html#ndbcontent

